Bundesgesetzgebungsverfahren – einfach erklärt
Vom Gesetzesantrag bis zur Kundmachung – was du drüber wissen solltest💡
Sijin Sun
Legal & Marketing
Recht 101
·Jus-Studium
Femininum

Wie kann ich Verwaltungsakte bekämpfen? 🥊
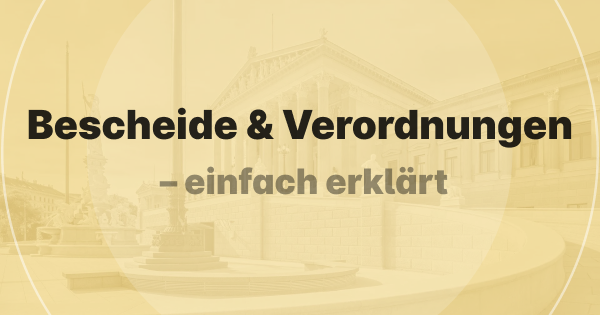
31. März 2025
·Recht 101
Jus-Studium
Was für Handlungsmöglichkeiten hat die österreichische Verwaltung? 🧐
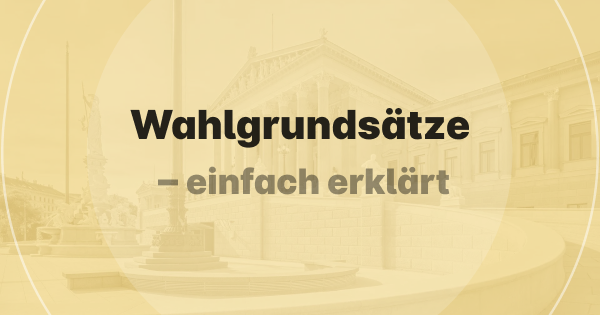
28. Februar 2025
·Welche Prinzipien sind bei Wahlen einzuhalten? 🥸
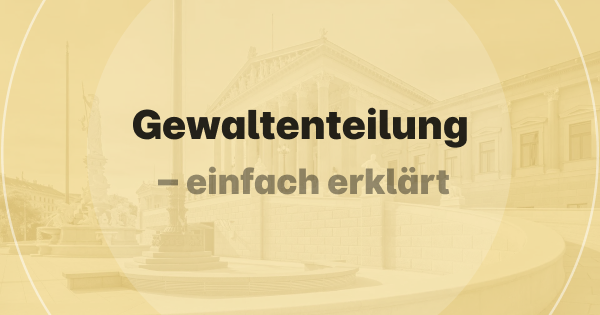
19. Februar 2025
·Welche 3 Staatsgewalten gibt es in Österreich? 🤔
Willkommen zu unserer einfachen Erklärung der Bundesgesetzgebung!
Hier klären wir nicht nur grundlegende Fragen wie: “Wie kann ein Gesetzgebungsverfahren starten?”, sondern geben dir auch tiefere Einblicke in den langen Weg, den jedes Gesetz zurücklegen muss, bevor es dir als Bürgerin begegnet.
Bevor wir uns der brennenden Frage “Wie entsteht ein Bundesgesetz?” widmen, möchten wir auf eine wichtige Grundlage hinweisen.
Der Stufenbau der Rechtsordnung sieht – vereinfacht dargestellt – so aus:
Grundprinzipien der Verfassung, mehr dazu erfährst du hier!
Bundesverfassungsgesetze
Bundesgesetze
Das bedeutet, dass untergeordnetes Recht übergeordneten Recht nicht widersprechen darf. Bundesgesetze dürfen also Bundesverfassungsgesetzen nicht widersprechen – und beide dürfen nicht gegen die Grundprinzipien der Verfassung verstoßen.
Je höher die Norm im Stufenbau ist, desto mehr Bedeutung kommt ihr also zu. Deshalb sind sie auch schwerer zu erzeugen!
Es gilt die Faustregel: Je höherrangig die Norm sein soll, desto schwerer ist sie zu erzeugen.
Einen Spezialfall bilden Bundesverfassungsgesetze, die eine Gesamtänderung eines Grundprinzips herbeiführen würden – diese müssen einer Volksabstimmung unterzogen werden. Sprich sie sind NOCH schwieriger zu erzeugen als “gewöhnliche” Bundesverfassungsgesetze.
Mit diesem wichtigen Grundgedanken im Hinterkopf starten wir nun ins Bundesgesetzgebungsverfahren…
Jedes Gesetzgebungsverfahren fängt mit einem Vorschlag an. Diese Vorschläge können, laut Art 41 Abs 1 & 2 B-VG (Bundes-Verfassungsgesetz), auf 4 verschiedene Arten eingebracht werden:
Antrag von Nationalratsabgeordneten
Antrag von Bundesratsabgeordneten
Antrag der Bundesregierung
Volksbegehren
Ein solcher Antrag kann von…
mind. 5 Abgeordneten = Initiativantrag, §26 GOG-NR
oder
einem Ausschuss = selbstständiger Antrag, §27 GOG-NR
eingebracht werden.
Der selbstständige Antrag eines Ausschusses muss einen inhaltlichen Zusammenhang zum Gegenstand des Ausschusses aufweisen.
Ein Ausschuss ist eine Gruppierung von Abgeordneten, die sich mit einem spezifischen Thema auseinandersetzen.
Der Bundesrat kann, gemäß §21 GOG-BR, durch…
Mehrheitsbeschluss oder
einem Drittel der Bundesratsmitglieder
einen Gesetzesantrag stellen.
= Regierungsvorlage
Die in der Praxis am häufigsten vorkommende Variante ist die der Regierungsvorlage.
Regierungsvorlagen werden durch die Bundesregierung, sprich allen Bundesministerinnen, einstimmig beschlossen. – Art 69 Abs 3 B-VG
Das Volksbegehren ist ein direkt demokratisches Instrument unserer Gesellschaft und ermöglicht Gesetzesinitiativen durch jede Person – also auch dir!
Um ein solches einzuleiten, müssen alle Voraussetzungen des §3 VoBeG erfüllt sein. Besonders zu erwähnen sind…
Unterstützungserklärungen im Ausmaß von 1-Promille der Wohnbevölkerungszahl Österreichs
Text des Volksbegehrens in Form eines Gesetzesantrages oder in Form einer Anregung
Eine Kurzbezeichnung des Volksbegehrens, die höchstens drei Wörter umfassen darf
Bestätigung über die Einzahlung eines Kostenbeitrags in der Höhe von 500€ auf ein Konto des Bundesministeriums für Inneres
Danach beginnt die 8-Tages-Frist, in der Eintragungen zur Unterstützung dieses Volksbegehrens möglich sind.
Ein Volksbegehren kann in 2 Formen unterstützt werden…
elektronischer (AustriaID) oder
persönlich vor einer Gemeindebehörde.
Erreicht das Volksbegehren am Ende der Eintragungsfrist mind. 100.000 Unterschriften, zieht es erfolgreich in den Nationalrat ein!
Wichtig! Daraus ergibt sich nur die Pflicht des Nationalrats sich mit dem Volksbegehren zu befassen, nicht aber es als Gesetz zu beschließen.
Der Nationalrat berät sich üblicherweise in 3 Lesungen:
In der ersten Lesung wird eine Debatte über die allgemeinen Grundsätze des Antrags geführt. Dann wird der Gesetzesentwurf einem Ausschuss zugeteilt der einen Prüfungsbericht darüber verfasst.
Es kommt zu keiner 1. Lesung bei einem selbständigen Antrag eines Ausschusses!
Die zweite Lesung besteht aus einer General- & Spezialdebatte des Gesetzesentwurfs im Nationalrat anhand des Prüfungsberichts. In der Generaldebatte wird die Vorlage als Ganzes besprochen und in der Spezialdebatte geht man genauer auf einzelne Teile der Vorlage ein.
In dieser Phase können also umfassende Änderungen am Gesetzesentwurf vorgenommen werden, weil die Abgeordneten den Entwurf genau prüfen und über Änderungen und Ergänzungen entscheiden.
Es ist auch die letzte Gelegenheit inhaltliche Änderungen vorzunehmen.
Die dritte Lesung ist, entgegen ihrem Wortlaut, nur die abschließende Abstimmung über den Gesetzesentwurf.
Es können höchstens oberflächliche Änderungen und Anpassungen vorgenommen werden.
Um die Abstimmung durchführen zu können, müssen bestimmte Quoren erfüllt sein!
Bei einfachen Gesetzen:
Anwesenheitsquorum: 1/3 der Abgeordneten müssen anwesend sein
Konsensquorum: 50% + 1 Stimme müssen dafür stimmen
Bei Verfassungsbestimmungen:
Anwesenheitsquorum: Mind. die Hälfte der Abgeordneten muss anwesend sein
Konsensquorum: 2/3 Stimmen müssen dafür stimmen
Eine Verfassungsbestimmung muss ausdrücklich als solche bezeichnet werden! – Art 44 Abs 1 B-VG
Nachdem der Nationalrat sich mit einer Vorlage auseinandergesetzt hat, kommt es zum Bundesrat.
Ausnahmen sind im Art 42 Abs 5 B-VG geregelt. Das sind z.B. die Geschäftsordnung des Nationalrats und Bundesbudgetangelegenheiten.
Der Bundesrat hat in der Regel 3 verschiedene Reaktionsmöglichkeiten…
Frist verstreichen lassen – Wenn der Bundesrat 8 Wochen verstreichen lässt, wird das “Schweigen” als Zustimmung gedeutet.
Zustimmung – Der Bundesrat kann ausdrücklich zustimmen innerhalb der 8 Wochen.
Einspruch = suspensives Veto – Der Bundesrat kann aber auch Änderungen vorschlagen oder grundsätzlich dem Gesetzesbeschluss widersprechen. Das tut er in Form eines suspensiven Vetos. Nur “suspensiv”, weil der Nationalrat einen Beharrungsbeschluss dagegen fassen kann, um den Gesetzesentwurf dennoch zu erlassen. Beim Beharrungsbeschluss muss die Hälfte der Nationalratsabgeordneten anwesend sein! – nur das Präsensquorum wird erhöht, Art 42 Abs 4 B-VG.
Doch genauso wie es Materien gibt, in denen der Bundesrat nicht mitwirken kann (siehe oben oder Art 42 Abs 5 B-VG), gibt es Materien, in denen es seiner ausdrücklichen Zustimmung benötigt! Z.B. bei Einschränkungen der Länderkompetenzen.
Gemäß Art 44 Abs 3 B-VG muss eine Volksabstimmung durchgeführt werden, wenn es sich um eine Gesamtänderung der Verfassung handelt. Hier geht es also um eine wesentliche Modifizierung eines Grundprinzips unserer Verfassung! – Erfahre mehr dazu in unserem Blog-Post “Verfassungsgrundsätze – die Grundprinzipien unserer Demokratie”.
Handelt es sich jedoch bloß um eine Teiländerung der Verfassung, so kann auf Verlangen eines Drittels des National- oder Bundesrates eine solche erfolgen.
Zum Beispiel ist Teil des republikanischen Grundprinzips, dass die Amtsperiode der Bundespräsidentin 6 Jahre beträgt, wobei eine Wiederwahl möglich ist – Art 60 Abs 5 B-VG
Eine Gesamtänderung dieses Grundprinzips läge vor, wenn die Funktionsdauer auf 20 Jahre verlängert wird.
Nur eine Teiländerung wäre es, wenn sie auf 7 Jahre verlängert wird.
Die Grenze ist grundsätzlich schwer zu ziehen!
Wenn eine Volksabstimmung nötig oder verlangt wird, entscheidet die Mehrheit. Das Ergebnis der Volksabstimmung ist rechtlich verbindlich!
Die Bundeskanzlerin legt nun den Gesetzesbeschluss der Bundespräsidentin zur Unterzeichnung vor. Diese prüft das verfassungsmäßige Zustandekommen des Gesetzes. Also etwa ob die Quoren eingehalten wurden und ob eine Verfassungsbestimmung als solche bezeichnet ist.
Erachtet sie das Zustandekommen des Gesetzes als rechtens, so unterzeichnet sie dieses.
Die Bundeskanzlerin zeichnet ihre Unterschrift gegen – sie beglaubigt also die Unterschrift der Bundespräsidentin.
Die Bundeskanzlerin hat anschließend die Aufgabe, das Gesetz offiziell im Bundesgesetzblatt kundzumachen. Das Gesetz tritt mit dem folgenden Tag der Kundmachung in Kraft, sofern kein anderes Datum für das Inkrafttreten im Gesetz festgelegt wird.
Ohne Kundmachung liegt kein Gesetz vor!
Wie du siehst, ist der Weg vom Vorschlag bis zum fertigen Gesetz ein vielstufiges und sorgfältig geregeltes Verfahren. Wir hoffen, dass du durch diesen Blog-Post einen guten Überblick über das Zusammenspiel verschiedener Organe – wie dem Nationalrat, Bundesrat und der Bundespräsidentin – im Bundesgesetzgebungsverfahren erlangt hast.
Durchforste weiter unseren Themenbereich “Grundlagen des Rechts” und finde noch mehr spannende Blog-Posts!